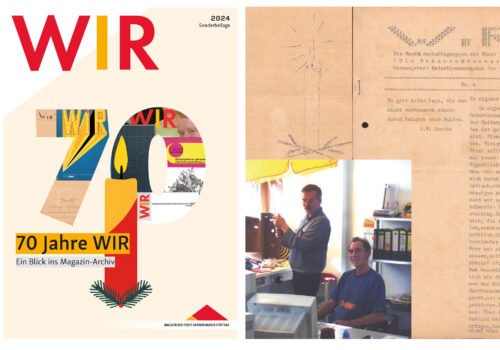Diakonie als Dienst am Menschen: Interview mit Dr. Ursula Schoen
Seit dem 1. September 2021 ist Dr. Ursula Schoen die neue Direktorin des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Zuvor war die Rheinländerin Prodekanin im Evangelischen Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach. Anlässlich ihres Antrittsbesuchs in der Fürst Donnersmarck- Stiftung gab sie dem WIR-Magazin ein ausführliches Interview über das Selbstverständnis der Diakonie, die Zukunft von Kirche und Diakonie in Berlin und Brandenburg sowie die Aufgaben der Diakonie beim Engagement für mehr Teilhabe und Inklusion. Das Gespräch führten wir im Februar 2022.
Der Werdegang von Dr. Ursula Schoen und ihr Weg zur Diakonie
Zu Beginn des Gesprächs möchten wir Sie bitten, sich unseren Leserinnen und Lesern kurz vorzustellen.
Ursula Schoen: Ich bin in den 1960er Jahren in Bonn geboren und groß geworden. Dort bin ich sehr früh mit der diakonischen Arbeit der Kirche in Kontakt gekommen, da meine Mutter in den 1970er Jahren als Ehrenamtliche die erste Sozialstation in Bonn mitbegründet hat und dort im Vorstand aktiv war. Die Station hat ganz neue Arbeitsformen und Modelle etabliert, um Menschen in schwierigen Lagen beizustehen. Dieses elterliche Vorbild, das auf einen sehr bewussten christlichen Glauben gründete, hat mich sehr beeindruckt und meinen ganzen Lebensweg begleitet. Meine Eltern haben sich aber auch gemeinsam mit anderen Bekannten früh für sogenannte russische Aussiedler engagiert und sie dabei unterstützt, in Deutschland anerkannte Berufsabschlüsse zu machen, sodass sie in eine für sie passende Berufstätigkeit kamen. Das war eine Arbeit, die Menschen einen Weg eröffnete, um in der neuen Heimat Westdeutschland Fuß zu fassen.
Ich selbst wollte zunächst Medizin studieren und habe zunächst bei den Johannitern eine Ausbildung zur Schwesternhelferin absolviert. Während meiner Arbeit im Krankenhaus merkte ich, dass mich diese Arbeit nicht wirklich interessiert, und bin zur Theologie gewechselt. Die Entscheidung habe ich nie bereut und bin bis heute eine sehr glückliche Theologin und Pfarrerin. Doch die Frage, wie wir Menschen beistehen können, wie wir sie unterstützen und wie wir mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten trotzdem in der Gemeinschaft zusammenleben, beschäftigt mich bis heute.
Das hat mich schließlich auch zur Diakonie geführt. Deswegen habe ich nach meinem Theologiestudium in Heidelberg noch ein Aufbaustudium in Diakoniewissenschaft absolviert und dort promoviert. Vor einem Jahr bin ich dann gefragt worden, ob ich nicht nach Berlin wechseln und das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz leiten möchte. Für mich war das eine gute Möglichkeit, in meinen letzten sieben Berufsjahren noch mal etwas ganz Neues machen zu können. Ich freue mich deswegen, an dieser Stelle noch einen guten Abschluss in meiner Berufslaufbahn machen zu können.
Sie stehen ja einem großen Landesverband vor, der sowohl Berlin als Hauptstadt oder die Landeshauptstadt Potsdam als auch viele kleinere Orte im übrigen Gebiet des DWBO vertritt. Wie sehr prägt denn der Unterschied zwischen Stadt und Land?
Ursula Schoen: Natürlich konnte ich durch die Pandemie bisher noch nicht so viel reisen, wie ich das gerne gemacht hätte. Aber glücklicherweise gibt es die modernen Kommunikationsmittel, die den Austausch sehr erleichtern. Man kann auch mit Görlitz verbunden sein, obwohl man in Berlin in der Nähe des Botanischen Gartens sitzt. Das ist ein großes Glück.
Für mich ist ein wichtiger Teil meiner Aufgaben auch die Kontaktpflege zu unseren Mitgliedseinrichtungen. Ich möchte wissen, was ihre Themen sind und was sie von uns brauchen. Deswegen nimmt das Reisen und die Besuche vor Ort sicherlich mindestens ein Drittel meine Arbeitszeit ein. Ich muss einen großen Verband leiten und mich um seine strategischen Eckpunkte kümmern. Ich muss aber auch im Austausch mit den Mitgliedern sein, wo es ja auch immer um konkrete Themen und strategische Überlegungen geht. Und das macht mir ungeheuer viel Spaß.
Die Diakonie versteht sich als „Dienst am Menschen“. Wie verstehen Sie vor diesem Hintergrund Ihre Arbeit? Als Leitungskraft hat man ja immer etwas mehr Distanz zu der direkten Arbeit vor Ort.
Ursula Schoen: Ich bin natürlich nicht im praktisch tätigen Dienst für den Menschen aktiv. Aber ich diene den Menschen auf eine andere Weise. Mein Ziel ist es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im DWBO zu begleiten und zu unterstützen, dass sie ihre Arbeit so gut wie möglich machen können. Damit schaffen wir eine Kaskade der Unterstützung, die am Ende bei den Menschen ankommen, die sie benötigen.
Darüber hinaus habe ich natürlich auch Verantwortung für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesgeschäftsstelle – für manche direkt, für manche indirekt. Es ist eine ganz wichtige Aufgabe von Führungskräften, genau hinzuhören, Rat zu geben und zwischen den Interessen einer großen Organisation und des Einzelnen zu vermitteln. Das können ganz alltägliche Dinge sein, wenn jetzt zum Beispiel in der Pandemie die Kinder erkranken oder man als Elternteil in Quarantäne gehen muss. Dann ist es meine Aufgabe, mit den Mitarbeitenden zu klären, wie diese privaten Aufgaben gemeistert werden können und dennoch die Arbeit weitergehen kann.
Die Diakonie als Sozialunternehmen
Die Diakonie und die diakonischen Einrichtungen haben seit ihrer Gründung ja eine große Entwicklung gemacht und sind zu Sozialunternehmen geworden, die auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeiten. Wie schafft man es, trotzdem eine diakonische Identität zu erhalten?
Ursula Schoen: Mir ist es immer wichtig, zunächst deutlich zu sagen, dass wirtschaftliches Arbeiten nicht unbedingt gewinnorientiertes Arbeiten heißen muss. Wirtschaftlich arbeiten heißt, die vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten so einzusetzen, dass sie den größtmöglichen Ertrag, die größte Wirkung bringen. Damit meine ich nicht nur den Blick auf das Geld, sondern auch auf die Menschen oder die Gebäude und Orte, die man hat. Man möchte nichts verschwenden, sondern Menschen ermutigen und entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, dass etwas möglichst Gutes herauskommt.
Gerade bei den ganz großen diakonischen Trägern beeindruckt mich sehr, wie viel Wert diese Organisationen auf eine gute interne diakonische Kultur legen. Dazu gehören Wertschätzung, die Förderung der Mitarbeitenden, Fortbildungen und vieles mehr. Das ist auch aufgrund des Fachkräftemangels wichtig. Wir können es uns überhaupt nicht mehr erlauben, Mitarbeitende nicht gut zu behandeln. Wir müssen für eine gute Unternehmenskultur aus christlichem Geist heraus einstehen, um Menschen für uns zu gewinnen und bei uns zu halten. Diakonische Einrichtungen müssen natürlich unternehmerisch denken, sie können aber ganz viel im Sinne der Diakonie leisten und haben oft eine sehr gute, diakonische Kultur.
Diakonisch sein bedeutet ja auch, sich zu fragen, wie man den Menschen sieht. Sehe ich Menschen in jeder Lebensphase als bildungsfähig an? Gebe ich mich mit Ausgrenzung zufrieden oder lebe ich inklusiv? Das sind alles Themen, die auch zur Diakonie und zum diakonischen „Setting“ gehören.
Aktuell habe ich aber das Gefühl, dass das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung etwas in den Hintergrund rückt und von anderen Themen überschattet wird.
Ursula Schoen: Die Frage nach dem Umgang mit Menschen mit Behinderung ist ein ganz brisantes Thema, bei dem sich gerade durch die Pränataldiagnostik noch mal der Druck auf die Gesellschaft und einzelne Personen erhöht hat. Dabei macht ja beispielsweise auch die Fürst Donnersmarck- Stiftung auf den wichtigen Umstand aufmerksam, dass der größte Teil der Einschränkungen im Leben erworben werden. Wir werden als Gesellschaft also immer mit Menschen mit Behinderung, mit starken und schwachen Menschen oder mit Menschen in belasteten oder unbelasteten Lebensphasen umgehen müssen.

Inklusion als zentraler Teil der diakonischen Arbeit
In Ihrem Einführungsgottesdienst haben Sie „Inklusion“ und „Teilhabe“ als zentrale Begriffe für Ihre diakonische Arbeit genannt. Welche Aufgaben sehen Sie da in Zukunft?
Ursula Schoen: Für mich ist die Grundlage immer ein Menschenbild, das davon ausgeht, dass wir alle Stärken und Schwächen haben. Ich meine das nicht sozialromantisch, sondern als eine Tatsachenbeschreibung. Wir alle haben unsere Schwächen und wir alle können – aus welchen Gründen auch immer – in eine Gefährdung kommen und Phasen der Schwäche erleben. Das ist Teil unseres Lebens. Wir werden alle Situationen erleben, mit denen wir nicht fertig werden oder in denen wir uns nicht als handelnde Personen empfinden.
Dieses Selbstverständnis ist die Grundlage unserer Arbeit. Macht und Ohnmacht, Selbstwirksamkeit und Passivität, Hilflosigkeit sind alles Dimensionen des Menschseins. Für mich bedeutet Inklusion, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der diese Dinge Raum haben. Das möchte ich auch nicht auf eine bestimmte Gruppe von Menschen beziehen, sondern diese Frage ist bei jedem und immer da, wenn auch jeden Tag anders.
Viele Menschen versuchen ja, so gut wie möglich ihre Einschränkungen und Fehler zu verbergen, anstatt sie auf den Tisch zu legen und um Hilfe zu bitten.
Ursula Schoen: Das ist absolut so. Ich möchte Ihnen gerne ein Beispiel erzählen, von dem ich neulich gehört habe. Darin ging es um einen 17-Jährigen, der sich in der Schule nie besonders angestrengt hatte. Er wurde nun in einen Ruderclub aufgenommen, weil er diesen Sport so gut kann. Und die Menschen aus dem Verein kümmern sich jetzt darum, dass er auch in der Schule besser wird.
Ich finde, das ist ein tolles Modell. Der Verein setzt an seinen Stärken als Ruderer an, unterstützt ihn aber auch bei seinen Schwächen. Das ist es, was ich sagen möchte. Wir brauchen eine fehlerfreundliche Gesellschaft, eine offene Gesellschaft, in der wir uns gegenseitig unterstützen und nicht nach den Defiziten bewerten.
Ich denke, dass die gegenseitige Unterstützung in unserer Gesellschaft wieder stärker werden müsste. Gerade am Anfang der Pandemie haben sich die Menschen ja oft auch gegenseitig geholfen.
Ursula Schoen: Es ist auch eine Aufgabe von Einrichtungen wie der Fürst Donnersmarck-Stiftung oder unserem Verband, Menschen zu zeigen, dass sie sich engagieren können, um anderen zu helfen. Wir haben im letzten Jahr während der Pandemie auch festgestellt, dass sich mehr Menschen für den Freiwilligendienst interessiert haben als in den Jahren davor. Es gibt also schon das Gefühl, dass man irgendwo mithelfen möchte. Das betrifft nicht nur junge Menschen, sondern auch Ältere.
Die Morde im Oberlinhaus und das Thema Gewaltprävention
Im letzten Jahr beschäftigte uns die Ermordung von vier Menschen mit Behinderung im Oberlinhaus in Potsdam sehr. Welche Rolle kann die Diakonie dabei spielen, Gewalt gegen Menschen mit Behinderung nicht entstehen zu lassen?
Ursula Schoen: Für mich ist das Geschehen im Oberlinhaus kein strukturelles Problem einer Einrichtung der Behindertenhilfe. Ich weiß, dass es dort eine lange Tradition gibt und man sich viel Mühe gibt, um Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Das ist für mich erst mal wichtig festzustellen. Aber leider müssen wir immer wieder erleben, dass es zu furchtbaren Gewalttaten kommt, weil Menschen einen inneren Hass haben – zuletzt ist das ja an der Universität in Heidelberg geschehen.
Gleichzeitig ist es gut, dass wir das Thema Prävention von Gewalt in der Diakonie stärker betont und uns damit intensiv auseinandergesetzt haben. Denn das Thema betrifft ja nicht nur diese unvorstellbaren Taten, sondern auch die kleinen Formen des Miteinanders im Alltag. Es geht darum, die Grenzen anderer zu respektieren, ihren Privatraum zu respektieren und vieles mehr. Als Verband können wir hierbei Impulse geben. Das ist eine wichtige Aufgabe. Allerdings muss man, glaube ich, auch ganz ehrlich sein: Solche Ereignisse können auch wieder vorkommen. Wir müssen aber unser Bestes tun, um sie zu verhindern.
Das Thema Gewaltprävention muss immer aktuell und präsent sein, damit das Risiko solcher Fälle m glichst gering ist.
Ursula Schoen: Das ist völlig richtig. Es muss klar sein, dass Gewalt nicht geduldet wird und so gar nicht erst die Rahmenbedingungen für Gewalt geschaffen werden. Zudem ist es aber auch wichtig, dass wir als Führungskräfte die Verfassung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick behalten müssen, um Überforderungen zu vermeiden.
Das kann beispielsweise die zeitgleiche Pflege der Angehörigen betreffen, was gerade bei älteren Mitarbeitenden immer wieder vorkommen kann. Dann habe ich als Vorgesetzte oft das Gespräch mit den betroffenen Personen gesucht und mit ihnen überlegt, wie wir die Arbeit organisieren können, bis diese belastende Situation vorbei ist. Das hat alles viel mit der Unternehmenskultur zu tun.
Ein weiteres wichtiges Thema, auf das Sie bereits hingewiesen haben, ist die Sozialraumorientierung der sozialen Arbeit. Welche Rolle können diakonische Unternehmen in diesem Prozess spielen?
Ursula Schoen: Zunächst mal sind diakonische Einrichtungen in vielen Sozialräumen ganz wichtige Akteure. Wenn Sie sich zum Beispiel Lobetal bei Bernau ansehen: Diese Organisation spielt sowohl als Arbeitgeber als auch als Impulsgeber eine ganz herausgehobene Rolle in der Region. Als diakonische Einrichtungen definieren wir an diesen Orten die Räume, an denen das Leben stattfinden, wo Gemeinschaft erlebt wird und wo neue Projekte hinkommen. Diakonische Einrichtungen können also wirklich innovativ agieren.
Und wie kann man sich das in einer Großstadt vorstellen, wo die einzelnen Bezirke sehr unterschiedlich sind und auch die Menschen, die dort leben, ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben?
Ursula Schoen: Wir dürfen natürlich nicht sagen, dass für alle dasselbe gut ist. Sozialraumorientierung heißt hier, dass wir in unserer Arbeit danach fragen, welche Ressourcen, aber auch Bedürfnisse es im sozialen Raum gibt. An diese Bedürfnisse und auch Problemlagen müssen wir dann unsere Angebote anpassen.
Und natürlich ist der Sozialraum immer schon ein gestalteter Raum, in dem Menschen mit ganz konkreten Vorstellungen und Ideen leben. Daran anschließend muss man sich fragen: Was verbindet uns hier? Was können unsere Aufgaben sein? Schauen Sie sich das Projekt 11Stadtteilmütter“ in Kreuzberg an. Dort wird die Situation vor Ort ernst genommen und ein Angebot vor Ort gemacht.

Die Rolle von Kirche und Diakonie in Berlin und Brandenburg
Sie haben sich ja bewusst dazu entschieden, an das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zu gehen. Sie sind damit in eine Gegend gekommen, in der die Kirche im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands nicht mehr so präsent ist. Haben Sie dennoch den Eindruck, dass die Diakonie hier in Berlin und Brandenburg gehört wird?
Ursula Schoen: Ja, wir werden gehört. Wir werden als Diakonie wahrscheinlich sogar mehr gehört als die Kirche. Auf der anderen Seite ist die Kirche in Berlin ja immer noch flächendeckend präsent. Ganz Berlin ist in Kirchenkreise eingeteilt, hat überall Orte sowie Anlaufstellen und kann deswegen Projekte wie „Laib und Seele“ umsetzen, das auf diesem Netzwerk beruht. Damit haben die Kirche und die Diakonie immer noch eine große Bedeutung und Einfluss in der Gesellschaft.
Allerdings müssen sich die katholische und evangelische Kirche beispielsweise die öffentliche Aufmerksamkeit inzwischen mit mehr Akteuren teilen. Früher war es selbstverständlicher, zu wichtigen Themen auch die Statements der Kirchen einzuholen.
Ursula Schoen: Trotzdem sind Diakonie und auch die Kirche – vielleicht in anderer Form als früher – ganz, ganz wichtige Sozialpartner für die Kommunen. Die Kommunen können überhaupt nicht anders, als auf die freien Träger – und dazu gehören auch die christlichen Träger zurückzugreifen, um das soziale Sicherungssystem aufrechtzuerhalten und für die Menschen zu sorgen, die Hilfe benötigen.
Die ehemalige Senatorin Elke Breitenbach sagte uns bei Ihrem Abschied aus dem Amt, sie hätte die Kirchen und die Diakonie in der Corona-Pandemie ganz neu entdeckt, da wir in der Lage waren, sehr schnell neue Hilfsangebote zu entwickeln. Zum Beispiel hat die Telefonseelsorge, die in Berlin ökumenisch ist, in nur ganz wenigen Wochen eine Corona-Telefonhotline aufgebaut. Dazu gab es die Struktur, die ehrenamtlich tätigen Personen und die Kontakte. Es wäre also unklug, wenn die Verantwortlichen auf kommunaler Ebene nicht erkennen, welche Ressource für die Gesellschaft die Diakonie bietet.
Welche Rolle wird denn aus Ihrer Sicht der Diakonie und der Kirche in Zukunft zufallen?
Ursula Schoen: Ich glaube, dass die Kirchen nach wie vor eine wichtige Rolle spielen und spielen werden bei der Bewältigung religiöser Fragen in der Gesellschaft – und zwar nicht nur im christlichen Sinne. Sie ist beispielsweise auch ein wichtiger Dialogpartner für muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger und für jüdische Gläubige.
Die evangelische und die katholische Kirche haben darüber hinaus nach wie vor große Ressourcen von ehrenamtlichen Menschen, die sich für andere einsetzen. Auch das wird weiterhin in den Stadtteilen und Gemeinden eine Rolle spielen. Die Kirche hat das große Plus, dass sie Orte zur Verfügung stellen kann, an denen sich Gemeinschaft vollziehen kann. Sie mögen nicht mehr ganz so viele Kirchengebäude wie früher besitzen, aber sie können immer noch Türen öffnen, Menschen einladen und soziale Arbeit ermöglichen. Ich würde mir wünschen, dass diese besonderen Orte bleiben werden. Ich war beispielsweise in der Taborkirche im Norden Kreuzbergs. Das ist eine der vielen Kirchen in Berlin, die einmal in der Woche ein Nachtquartier anbietet. Das ist ein ganz besonderer Ort, wenn man dort ist und von den Menschen begrüßt wird. Unsere Orte mit ihrer langen Tradition sind auch ein großer Schatz.
Ist das auch ein Schlüssel zur Sozialraumorientierung? Dass die Diakonie Infrastruktur und Koordination anbieten kann? Dass Sie Menschen – ob ehrenamtliche oder andere Akteure – zusammenführt und in einem gemeinsamen Projekt zusammenbringt?
Ursula Schoen: Absolut. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Es ist unser Auftrag, mit Menschen über Fragen der Existenz des Lebens und der Hoffnung im Gespräch zu bleiben. Das sehe ich immer so.
Vielen Dank für das Gespräch
Das Interview führte Anke Köhler für das Wir-Magazin 1/2022 im Februar 2022.